Schienenträume
wie auch immer Sie in diesem Sommer an Ihren Ferienort gekommen sind, eines werden Sie dabei ganz sicher festgestellt haben: Wenn man mal von ausgedehnten Radwanderungen absieht, gilt innerhalb Europas noch immer: Je ökologischer unterwegs, desto teurer wird es. Und zwar deutlich. Die Zahlen, die Greenpeace gerade in einer Studie ermittelt hat, sind ebenso verblüffend wie erschreckend. Auf 112 europäischen Strecken, darunter auf so reizvollen Routen wie Berlin-Rom, Köln-Barcelona und München-Göteborg, ist es in 71 Prozent der Fälle billiger zu fliegen als mit der Bahn zu fahren. Im Durchschnitt kostet der Schienenweg 51 Prozent mehr. Extrembeispiel ist die Verbindung Barcelona-London, für die per Zug 384 Euro berappt werden müssen. Wer fliegt, zahlt den Gegenwert von vier Cappuccino – 12,99 Euro.
Dass eine solche klimafeindliche Verkehrspolitik in diesem postpandemischen Jahr wieder mehr Menschen denn je zum Fliegen animiert, führt dann zu verrückten Parallelen wie dieser: So war dieser Juli weltweit nicht nur der heißeste Monat seit 120.000 Jahren, er verzeichnete auch den Tag mit den meisten Flugzeugen gleichzeitig am Himmel – 134.386 am 6. Juli. Schon erstaunlich, dass es günstiger sein soll, neben dem ganzen Flughafen- und Sicherheitsschleusengedöns, einen tonnenschweren Jet energieaufwändig mit Sack und Pack in die Luft zu hieven – also ein technisches Wunder zu vollbringen – statt vergleichsweise einfach über eine Schiene dahin zu geiten, oder? Möglich sind solche Preisunterschiede nicht zuletzt, weil auf Kerosin und Flugtickets – im Gegenzug zu Energiekosten und Fahrkarten bei der Bahn – keine Steuern erhoben werden. Auch die Gewinne behalten vor allem Billig-Airlines dank fiskalischer Ausweichmanöver beinahe vollständig für sich. So verzeichnete das irische Unternehmen Ryanair im ersten Halbjahr 2023 einen Überschuss von 663 Millionen Euro – Rekord.
„Zu voll, zu alt, zu kaputt“
Und die Bahn? Rutscht trotz immer höherer Ticketpreise immer tiefer in die roten Zahlen, insbesondere die Bahn-Tochter DB-Netze: In den ersten sechs Monaten des Jahres hat dieser Unternehmenszweig rund 240 Millionen Euro Verlust gemacht. Fast eine Viertel Milliarde. Auch die Logistiktochter DB-Cargo sackte 200 Millionen Euro tief in die Miesen. Verrechnet mit den Einnahmen in anderen Bereichen landet die Deutsche Bahn bei insgesamt minus 71 Millionen Euro, rechnete Bahnchef Richard Lutz vor, der sich selbst dennoch über eine Verdopplung seines Gehalts freuen darf. Als Anerkennung für die geleisteten Dienste.
Mehr Passagiere, mehr Güter auf der Schiene, das kostet nun mal. „Zu voll, zu alt, zu kaputt“, klagte der aktuelle Infrastrukturchef Berthold Huber, der 2022 das schwere Erbe angetreten hat. Insider sprechen vom „Pofalla-Effekt“: In der Amtszeit des ehemaligen Infrastrukturvorstandes und früheren CDU-Kanzleramtsministers Roland Pofalla wurde zu wenig Geld in die Schiene investiert. Die CSU-Dreifaltigkeit aus den autofreundlichen Verkehrsministern Ramsauer, Dobrindt und Scheuer tat ihr Übriges, und FDP-Mann Volker Wissing scheint, abgesehen von kleineren Zugeständnissen, diese Tradition fortführen zu wollen. Umso pikanter, dass Tobias Bareiß, Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die roten Zahlen der Deutschen Bahn in dieser Woche in der Bild-Zeitung als „eine Art Arbeitsverweigerung“ bezeichnete. Wen meint er damit noch gleich? Ja wohl kaum das Personal, das unermüdlich gegen alle Unzulänglichkeiten und den Unmut der Reisenden anarbeitet und jede Lohnerhöhung mühsam erstreiken muss.
Rettet das Kartcenter!
Der katastrophale Gesamtzustand der deutschen Bahn zeigt sinnbildlich, wie schwer sich konservative und liberale Minister mit vorausschauender Politik tun. Im Lokalen demonstrieren aber selbst Sozialdemokraten eine erstaunliche Unfähigkeit zur Weitsicht. In der Lüneburger Heide soll laut Bundesverkehrswegeplan auf der neu geplanten, deutlich kürzeren Strecke Hamburg-Hannover eine Schienentrasse durch ein Gewerbegebiet in Bispingen führen – mitten durch das Kartcenter „Ralf Schumacher“, gleich neben einer Skihalle, einem Logistikzentrum, massig Parkplätzen und einer Tankstelle. Geplant ist die Verbindung seit den Sechzigerjahren (!), so plötzlich kommt das Vorhaben also nicht. Trotzdem protestieren die Bürgerinnen und Bürger. Ihr mächtiger Verbündeter: Lars Klingbeil, in dessen Wahlkreis das Gewerbegebiet liegt. Ein besseres, leistungsfähigeres Bahnnetz schön und gut, wenn es aber um die reale Umsetzung geht, wird das Auto plötzlich doch wieder zum „Verkehrsmittel Nummer eins hier im Heidekreis“, wie es der SPD-Chef ausdrückt. Und fordert einen zügigen Ausbau der A7 auf sechs Spuren, die ebenfalls mitten durch seinen Wahlkreis führt, aber für Klingbeil anscheinend weniger Akzeptanzprobleme zu haben scheint.
Diese kaum wieder wettzumachende jahrzehntelange Ausbremsung von Wartung und Ausbau, die auch zwischen Hannover und Hamburg zu Zwangssanierungen und Sperrungen führen wird – von der drängenden Erweiterung des Schienennetzes mal ganz abgesehen – bekommen die Fahrgäste täglich zu spüren: Die Züge sind so teuer und unpünktlich wie noch nie. Wer ernsthaft mit dem Zug verreisen will, muss lange im Voraus buchen und Puffer einplanen. Und, siehe oben, viel Geld beiseite legen.
Hoffnungsträger Deutschlandticket
Umso mehr Hoffnung macht trotz des ganzen Schlamassels der Erfolg des Deutschlandtickets, das seit Mai elf Millionen Mal gebucht wurde. Es gibt also eine riesige Nachfrage nach einer bezahlbaren, zuverlässigen Bahn samt angeschlossenem Nahverkehrssystem. Andere europäische Länder lassen sich davon inspirieren, Slowenien hat ein ähnliches Modell eingeführt, in Frankreich wird darüber nachgedacht. Warum also nicht gleich groß denken: Wann kommt endlich das Europaticket? Also Interrail zu Ende gedacht, günstiger als 100 Euro, finanziert durch eine faire Besteuerung des Luftverkehrs zum Beispiel. Ich würde darauf fliegen.
Kommen Sie gut an Ihr Ziel!
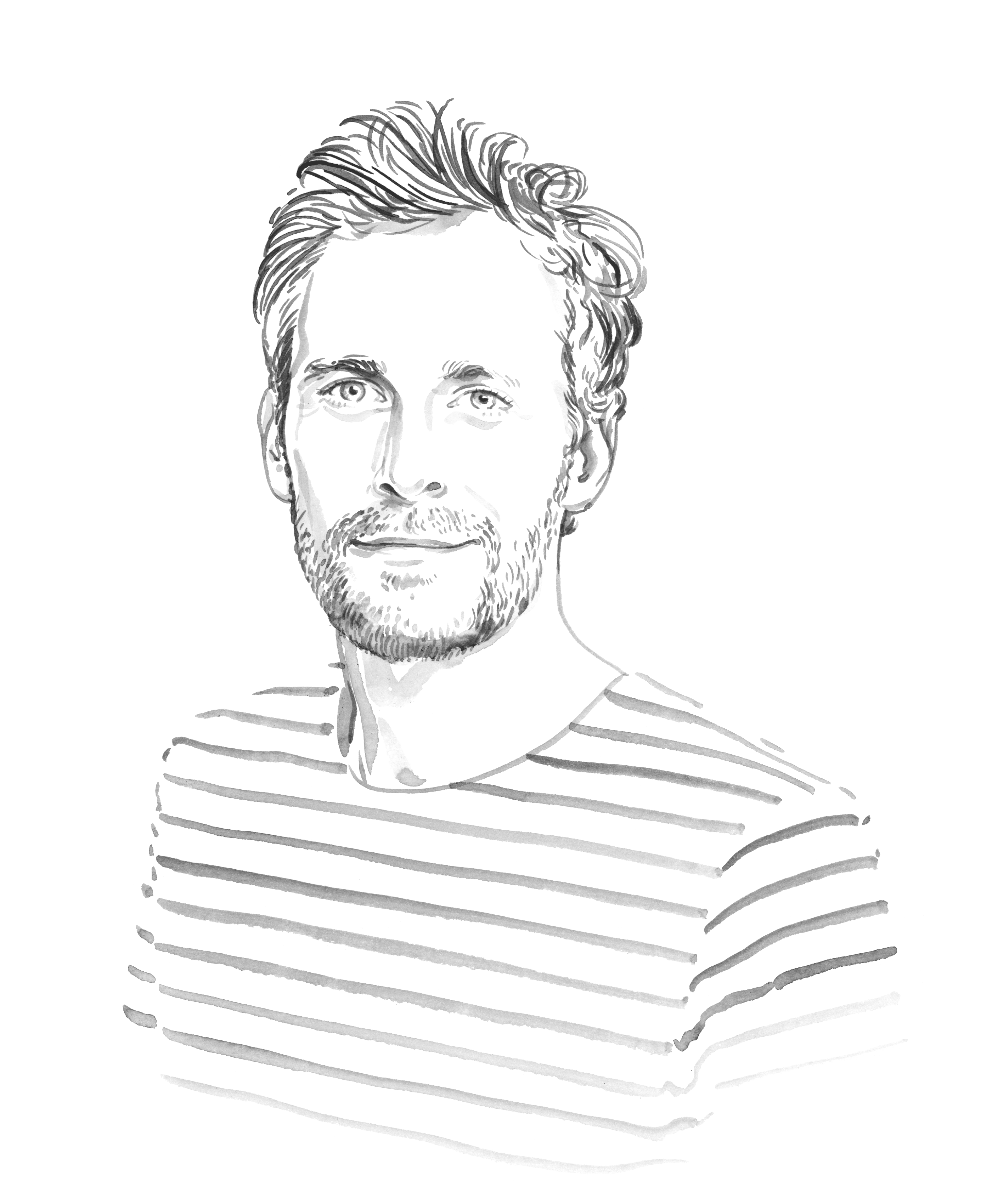

Thomas Merten
Redakteur
Sommer, nicht ganz frisch
Sommerpause. Das Parlament liegt verlassen da, vielerorts sind Schul-, Semester- oder Werksferien, an Läden hängen Schilder: „Wir machen Urlaub von…bis…“, und im Fernsehen haben sie teils schon im Mai den üblichen Sendebetrieb heruntergefahren und fangen im September wieder an – wobei man sich von manchen Quassel- und Quatschsendungen wünscht, die Pause möge am 1. Januar beginnen und am 31. Dezember nicht enden. Als Ersatz wird Konservennahrung in Gestalt von betagten Spielfilmen, Tatort-Wiederholungen oder seichten Sommerkomödien gereicht. Selber schuld, wer alt, arm oder anders gehandicapt und nicht verreist ist.
Also ab in die Wärme? Kann man wohl sagen. Eine kleine Grad-Wanderung von Rom (41,8) über Sa Pobla, Mallorca (43,9), Theben nahe Athen (44,2), Phoenix, Arizona/USA (46,7) bis nach Sanbao, China (52,2), Temperaturen gemessen in diesem Juli. Reisenden, die es etwa in den Mittelmeerraum zieht, möchte man hinterherrufen: Wollt ihr es euch nicht noch mal überlegen? Heute neu reingekommen: 15,7 Grad. Wie angenehm! Aber von wegen Sommerfrische – Rekordtemperatur auf dem Hohen Sonnblick, mit 3106 Metern einer der höchsten Berge Österreichs, gemessen am 11. Juli. Rund zehn Grad über dem Durchschnitt.
Die Klimakrise macht definitiv keine Sommerpause, ganz im Gegenteil. Sie schwitzt und schuftet, lässt ihre gut definierten Muskeln spielen und bietet mal wieder einen Vorgeschmack auf kommende Zeiten. Der Sommer 2022 war in Europa der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, mit über 60.000 Toten. Gut möglich, dass auch dieser traurige Rekord in diesem Jahr gerissen wird. Extreme Hitze koste in den meisten Jahren in den USA mehr Menschenleben als Hurrikane, Überflutungen und Tornados zusammen, schreibt der Scientific American. Und sie sorgt für Dürren, Wasserknappheit, Hunger und Fluchtbewegungen.
Flucht – darüber denken auch die 12.000 Einwohner und Einwohnerinnen des winzigen pazifischen Inselstaats Tuvalu nach. Nicht wegen der Hitze, sondern wegen des steigenden Meeresspiegels, der ihre drei Koralleninseln und sechs Atolle in nicht allzu ferner Zukunft unbewohnbar machen wird. Nur, wohin sollen sie? Einige sind bereits nach Neuseeland ausgewandert, aber das ist keine Option für alle, und die meisten wollen eigentlich auch gar nicht weg. Einstweilen haben sie den Plan gefasst, einen digitalen Zwilling zu erschaffen, um ihre kulturelle Identität, aber auch die Landschaft wenigstens in virtueller Form zu erhalten.
Umziehen müssen auch die Menschen aus Newtok, Alaska, weil das Dorf langsam aber sicher im schmelzenden Permafrostboden versinkt. Das ist seit Jahren bekannt. Es gibt sogar einen Ort, Mertarvik, wo schon 200 Leute hingezogen sind, aber die staatlichen Finanzhilfen für die im Prinzip bewilligte Umsiedlung fließen nur spärlich und unregelmäßig, und so harren die übrigen 200 auf schwankendem Grund aus und sehen der Infrastruktur beim Zerbröckeln zu.
Nicht nur Menschen müssen vor der Erderhitzung in Sicherheit gebracht werden (obwohl ja Urlaubende in Europa derzeit gerade das Gegenteil tun), sondern auch: Gletscher. Keine kompletten natürlich, die sind sowieso nicht zu retten, aber immerhin Eisbohrkerne aus verschiedenen Regionen. Die Initiative „Ice Memory“ will sie bei minus 50 Grad in der Antarktis zu Archivierungszwecken konservieren, weil sie wichtige Erkenntnisse über die Geschichte der Erde, der Atmosphäre und der Menschheit bergen.
Das Gute an diesem Unterfangen: Die Fluchthilfe ist nicht strafbar, Eisbohrkerne brauchen keine Visa und müssen kein Asyl beantragen. Wenn es nach dem CDU-Politiker Torsten Frei geht, ist das individuelle Asylrecht sowieso ein menschenrechtliches Fossil und gehört abgeschafft. Angesichts solcher Vorschläge frage ich mich, und das nicht zum ersten Mal, wie eigentlich das „C“ in den Namen der Partei geraten ist, das ja für „christlich“ steht. Gut, 1. Mose 1:28 haben sie offenbar verinnerlicht („Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.“)
Aber war in der Bibel nicht auch von Nächstenliebe die Rede? Und was haben sie immerfort an der Schöpfung auszusetzen, sollten Konservative diese nicht bewahren und pflegen? „Und Gott sah, dass es gut war.“ Ja, Gott vielleicht, aber die christlichen Parteien halten das Werk offenbar für weniger gelungen. Deshalb muss man weiterhin Gifte auf den Feldern verteilen (gern auch etwas Gentechnik hinzufügen), Moore trockenlegen, Flüsse begradigen, Straßen bauen, fossile Brennstoffe verheizen, Wälder abholzen, durch die Gegend rasen, Massentierhaltung heiligen und EU-Naturschutzgesetze zu torpedieren versuchen, was letztlich misslang, zumindest vorläufig. Andere Parteien denken ähnlich, aber die haben auch kein C im Namen.
Seltsame Vorschläge aus manchen Parteien, ein mutmaßlicher Betrüger namens Jan Marsalek oder zumindest ein angeblicher Brief desselben, eine Löwin oder ein anderes großes Tier in Brandenburg – wer weiß, was noch alles aus dem Sommerloch aufploppt. Ich jedenfalls brauche jetzt auch mal eine klitzekleine Pause. Die werde ich in nördlichen Gefilden verbringen, die derzeit nicht unter Extremhitze leiden, teils in der Nähe eines Sees. Nessie wurde dort bislang nicht gesichtet. Irgendwann im August melde ich mich dann zurück.
Wenn Sie mögen, leiten Sie diese Wochenauslese gern weiter. Abonnieren können Sie sie übrigens hier. Und wenn Sie auch unsere Presseschau zu Umwelt- und Klimathemen lesen möchten, können Sie sich hier dafür anmelden – dann halten wir Sie montags bis freitags auf dem Laufenden. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!
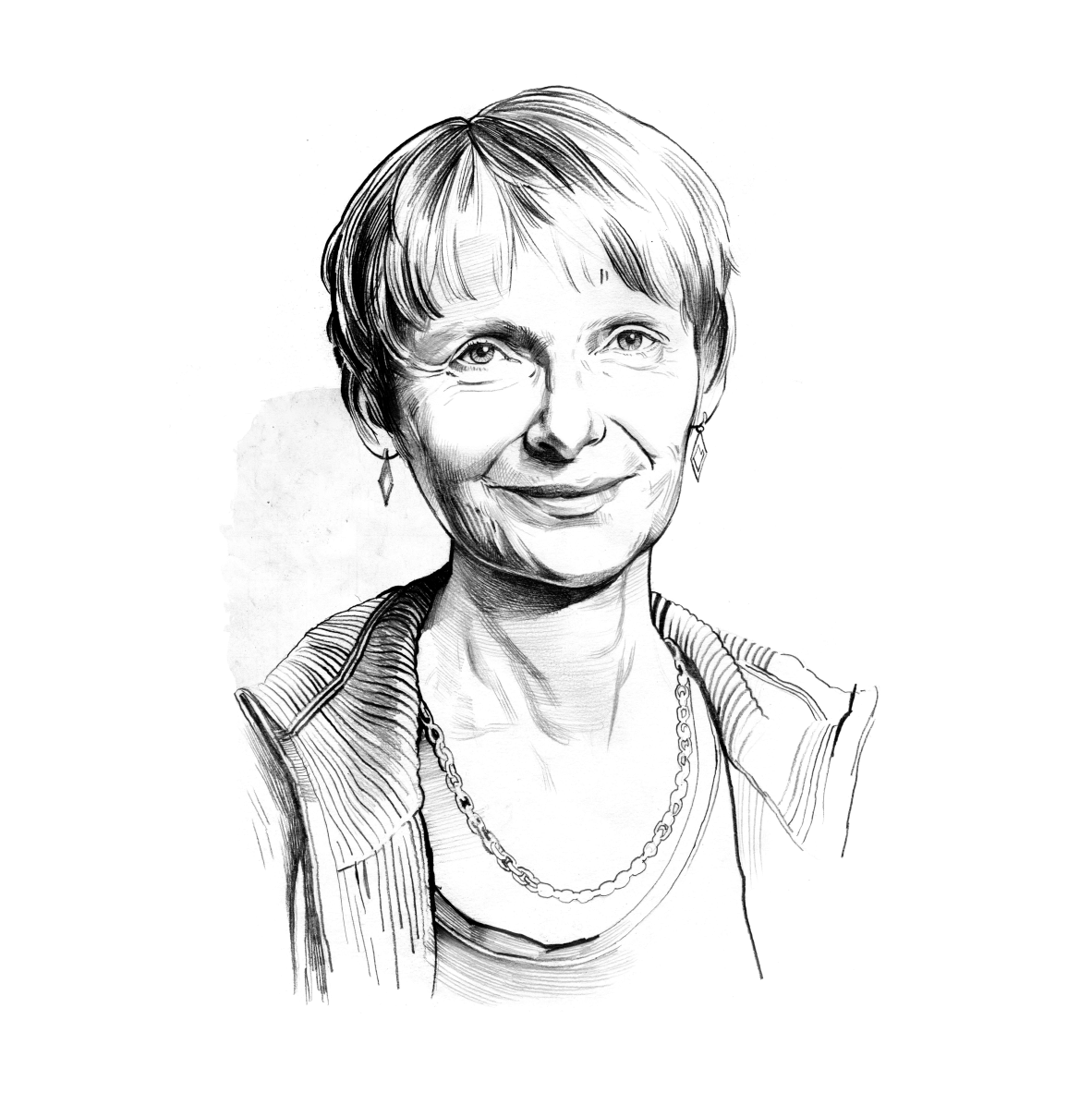
Kerstin Eitner
Redakteurin
Platz da – aber wo?
„Rentner blockieren große Wohnungen“, titelte einst Focus Online. Au weia. Zeit für Wohnscham, denn auch ich beziehungsweise wir bewohnen zu zweit knapp 130 klima- und umweltpolitisch verwerfliche Quadratmeter, und das bei dem vor allem in Ballungsräumen herrschenden Wohnraummangel. Zu meiner Verteidigung kann ich vorbringen: kein Auto, weder Flug- noch sonstige Luxusreisen, Erwerbstätigkeit im heimischen Arbeitszimmer schon lange vor der Erfindung des Homeoffice.
Aber ach, die armen Familien! Sollte man nicht besser umziehen? Leichter gesagt als getan. Denn ich bin das einzige Überbleibsel der wechselnden, teils extrem chaotischen Wohngemeinschaften, drei, vier, manchmal auch mehr Leute, die sich in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts vier Zimmer, zwei Abstellkammern, Küche, Bad, Klo und einen übertrieben riesigen Flur teilten. Das heißt: Wir haben einen alten Mietvertrag und daher eine sehr günstige Miete.
Was auch daran liegt, dass wir vor über dreißig Jahren auf eigene Kosten eine, ähem, Gasetagenheizung haben einbauen lassen, nicht ahnend, dass wir uns damit einmal direkt ins Reich des Bösen begeben würden. Damals schien es eine grandiose Idee zu sein, Ersatz für eine noch weit schlimmere Heizart: Kohleöfen (Briketts schleppen! Asche entsorgen! Das Grauen!!); wir blieben im Rasterfeld B4 des Mietenspiegels (mit Bad oder Sammelheizung) und damit bis heute von exorbitanten Mieterhöhungen verschont.
Nehmen wir mal an, wir trügen uns mit Umzugsgedanken. Da würde man sich natürlich nicht unbedingt verschlechtern wollen.
„Ja, das möchtste:
Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse,
vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße;
mit schöner Aussicht, ländlich-mondän,
vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehn –
aber abends zum Kino hast du´s nicht weit.
Das Ganze schlicht, voller Bescheidenheit.“
So märchenhaft wie in Tucholskys Gedicht müsste die Bleibe gar nicht sein. Jedoch: Ein Balkon wäre zur Abwechslung nicht übel, eine weniger laute Umgebung ebenso wenig, aber bitte trotzdem nicht zu weit weg, keinesfalls am Stadtrand und schon gar nicht auf dem Land.
Mal angenommen, man fände was – jede Wette, es wäre eher halb so groß und kaum billiger als unsere derzeitige Wohnung. Nach deren Renovierung könnte die Vermietungsgesellschaft ohne Weiteres die doppelte Miete kassieren, denn die darf ja bei jeder Neuvermietung erhöht werden. Womit niemandem gedient wäre, weil es ja vor allem an bezahlbarem Wohnraum fehlt. Wohnungstausch – das klingt nicht schlecht, scheitert in der Praxis aber häufig.
Auf dem Land läuft auch nicht alles rund: Das Einfamilienhaus mit Garten, Kugelgrill, Carport, Trampolin und Plantschbecken (gibt es eigentlich noch Jägerzäune und Gartenzwerge?), der ewige Traum der meisten Deutschen, ist aus ökologischer Sicht häufig ein Albtraum, vor allem, wenn es in den Vororten liegt, den „Speckgürteln“ der Städte. Ausufernde Eigenheimsiedlungen, gern errichtet in frisch ausgewiesenen Neubaugebieten, führen zu dem allseits gefürchteten Donut-Effekt in Dörfern und Städten – im Innenbereich Leerstand, außerhalb Siedlungsbrei und Flächenfraß. Wird die Immobilie irgendwann vererbt, heißt es oft: Verkauf, Abriss, Neubau.
Die große Koalition hielt es kurz vor der letzten Bundestagswahl für eine gute Idee, diese Fehlentwicklung in Gestalt von § 13 Baugesetzbuch zu zementieren. Dieser noch relativ neue Paragraph regelt die „Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren“. Umwelt- und sonstige Verträglichkeitsprüfungen für Siedlungserweiterungen am Ortsrand entfallen, es gilt das Mantra „Bauen, bauen, bauen“.
Nicht alle spielen mit. Michael Werner-Boelz (Grüne), Bezirksamtsleiter in Hamburg-Nord, erklärte bei seinem Amtsantritt im Februar 2020, in seinem Bezirk kein Einfamilienhaus mehr genehmigen zu wollen. Die Wohnungsnot lässt sich damit ohnehin nicht beheben, denn so ein Haus kostet in Hamburg leicht mal 800.000 Euro, die man erst mal haben muss. Doch als Anton Hofreiter, damals noch Fraktionschef der Grünen im Bundestag, 2021 in einem Interview danach gefragt wurde und seine Skepsis gegenüber dieser Wohnform erklärte, sorgte das erwartungsgemäß für große Aufregung. Dieses Jahr hat nun auch die Stadt Münster (der Bürgermeister ist von der CDU) beschlossen, den Neubau von freistehenden Einfamilienhäusern zu beschränken, weitere Städte könnten nachziehen.
Patentlösungen sind nicht in Sicht. Interessante Ideen gibt es aber durchaus, von der Nachverdichtung auch bei Einfamilienhäusern, der Verwendung ökologischer Baumaterialien, neuen Wohn- und Arbeitskonzepten wie Coworking Spaces bis zu zügiger Digitalisierung und vielem anderen.
Es müsste eine Bestandsaufnahme her – und ein vernünftiger Gesamtplan. Man ahnt irgendwie, dass das mit den real existierenden und regierenden Parteien schwierig wird. Wenn man an das Gezerre und Gekeife um das Gebäudeenergiegesetz denkt, wird einem ganz anders bei der Vorstellung, es ginge nicht „nur“ um Heizen und Energieverbrauch, sondern um das Wohnen der Zukunft. Dabei ist eins klar: „Weiter so“ ist keine Option.
Also: Wenn jemand eine bezahlbare Wohnung im Innenstadtbereich von Hamburg im Angebot hat, zwischen Schuhschachtel- und Palastgröße, mit Balkon, verkehrsgünstig gelegen, aber nicht an einer viel befahrenen Straße, bitte melden. Nur ernst gemeinte Zuschriften!
Nächste Woche produzieren wir ein neues Greenpeace Magazin. Wir melden uns so bald wie möglich wieder.
Wenn Sie mögen, leiten Sie diese Wochenauslese gern weiter. Abonnieren können Sie sie übrigens hier. Und wenn Sie auch unsere Presseschau zu Umwelt- und Klimathemen lesen möchten, können Sie sich hier dafür anmelden – dann halten wir Sie montags bis freitags auf dem Laufenden. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!
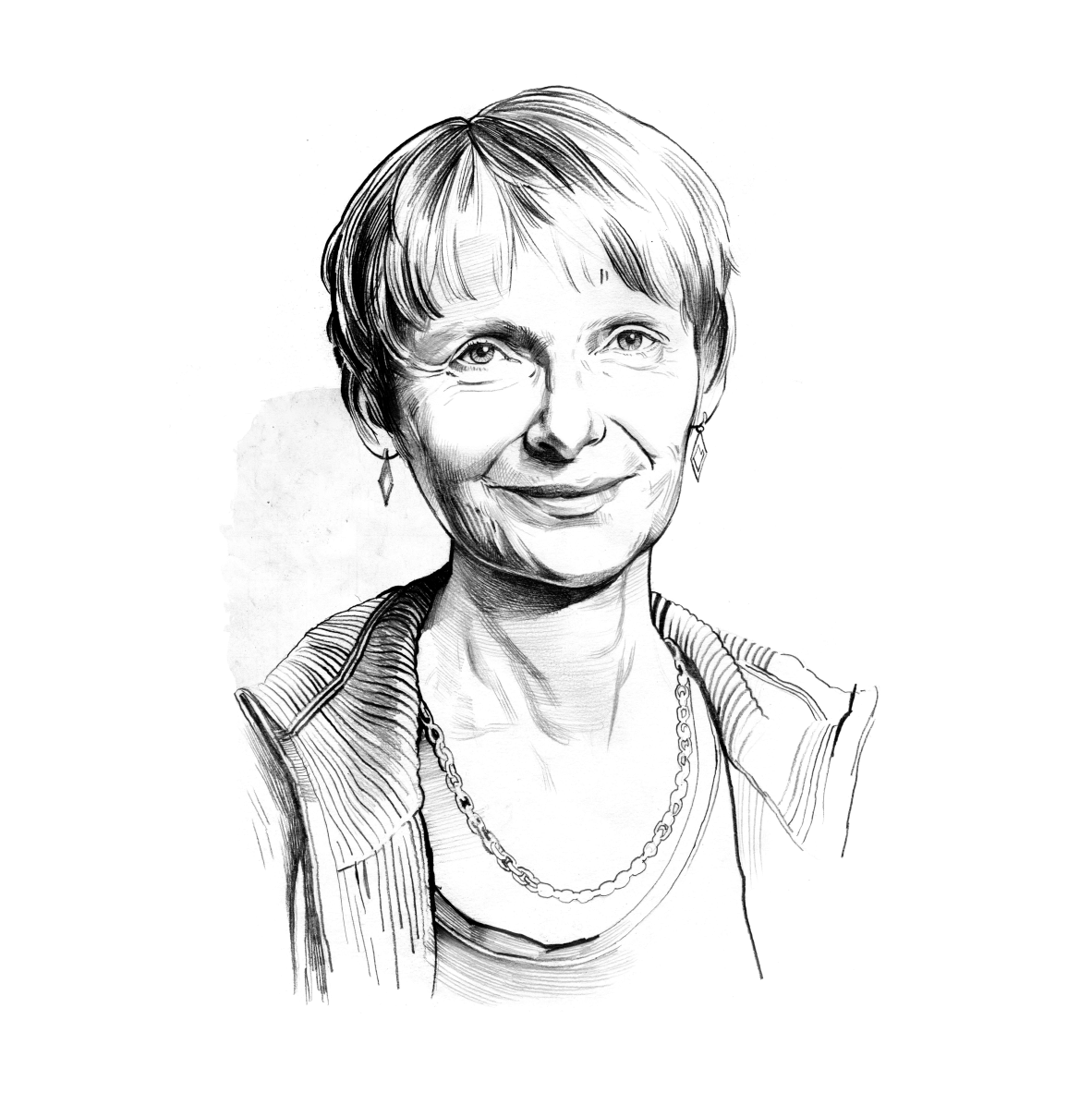
Kerstin Eitner
Redakteurin
Über das Meer
Sommerferien! Zwischen dem 22. Juni und dem 11. September müssen sich deutsche Familien, die in den Urlaub fahren können und wollen, entscheiden: Berge oder Meer? Als Kind der Insel Sylt müsste ich nicht lange überlegen: „Meine Liebe zum Meer, dessen ungeheure Einfachheit ich der anspruchsvollen Vielgestalt des Gebirges immer vorgezogen habe, ist so alt wie meine Liebe zum Schlaf.“ Ist nicht von mir, sondern von Thomas Mann. Lange bevor Sylt zu der gruseligen „Promi-Insel“ verkam, die es heute ist, zog es auch ihn dorthin, so wie viele andere Schriftsteller, Malerinnen, Bildhauer, Tänzerinnen und Verleger.
Die Insel mag sich gründlich verändert haben, das Meer aber sieht oberflächlich noch immer so aus wie früher, als ich darin schwimmen lernte, und fühlt sich offenbar zumindest an der Nordseeküste auch so an. Die Wassertemperaturen sind nämlich momentan in etwa so, wie man sie zu dieser Jahreszeit erwarten kann: 18 Grad Celsius. „Ab 16 Grad können wir reingehen“, befand meine Mutter jedes Jahr um diese Zeit, und so geschah es. Für ausgesprochene Weicheier ist die Nordsee wohl eher nichts.
So frisch ist es derzeit nicht überall. Der Nordatlantik etwa übertraf vor knapp zwei Wochen den bisherigen Wärmerekord von 2010 um ein halbes Grad. 22,7 Grad Celsius betrug die Durchschnittstemperatur. Das klingt nach einem moderaten Anstieg, für einen Ozean ist es jedoch alarmierend. Der Sauerstoffgehalt kann sich verändern, Korallenriffe können absterben, Algen zu nie gesehener Blüte gelangen, mehr Tropenstürme auftreten. Auch die Unwetter der letzten Tage in Deutschland könnten mit den ungewöhnlich warmen Meeren zu tun haben.
Bereits im April lagen die Meerestemperaturen um 0,7 Grad über dem langjährigen Mittelwert. Örtlich können sie aber deutlich höher sein. Im Pazifik wird Ähnliches beobachtet, etwa vor Peru und Ecuador. Expertinnen und Experten sind alarmiert, laut Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ist das „schon eine extreme Temperaturabweichung nach oben“. In Fachkreisen hält man El Niño für einen der Schuldigen. Auch die mexikanische Regierung macht das zyklisch auftretende Wetterphänomen für das Sterben Hunderter Seevögel verantwortlich, die kürzlich an der Pazifikküste des Landes gefunden wurden.
El Niño, weniger Schwefelaerosole in der Atmosphäre infolge der seit 2020 geltenden niedrigeren Grenzwerte für Schifffahrtskraftstoffe, wenig Saharastaub über dem Atlantik – all diese Faktoren tragen mutmaßlich zu dem exorbitanten Temperaturanstieg bei, dürften aber insgesamt eher eine Nebenrolle spielen. Denn einer im Fachmagazin Earth Systems Science Data veröffentlichten Studie zufolge hat die Erde zwischen 1971 und 2020 unfassbare 381 Zettajoule an zusätzlicher Wärme aufgenommen (eine Zahl mit 21 Nullen, also so was hier: 381 000 000 000 000 000 000 000). Und 89 Prozent dieser Energie stecken wo? In den Meeren.
Das bedeutet vermutlich, dass weltweit die Meeresspiegel ein paar Jahrhunderte lang weiter steigen werden, selbst wenn ein Wunder geschähe und plötzlich überhaupt keine Treibhausgase mehr ausgestoßen würden. Die Ozeane absorbieren mehr klimaschädliches CO2, als sich derzeit in der Atmosphäre befindet. Leider gilt: Je wärmer das Wasser, desto geringer die Speicherkapazität.
Dabei haben die Vereinten Nationen gerade an diesem Montag unter dem Jubel der Delegierten das Anfang März ausgehandelte Abkommen zum Schutz der Weltmeere verabschiedet. Es erlaubt erstmals auch die Einrichtung von Schutzzonen in der Hochsee. Großen Anteil daran, dass die Meere im internationalen Seerecht überhaupt als schützenswertes und überlebenswichtiges Gemeingut angesehen werden, hatte übrigens Elisabeth Mann Borgese, fünftes der sechs Kinder von Katia und Thomas Mann (und dessen erklärter Liebling). Sie liebte das Meer mindestens so sehr wie ihr Vater, war maßgeblich am UN-Seerechtsübereinkommen von 1982 beteiligt sowie an der Schaffung des Internationalen Seegerichtshofs.
Was das nun für die Auswahl Ihres Urlaubsziels bedeutet, weiß ich auch nicht. Aber wenn es das Meer sein soll: Wählen Sie eins, für das Sie nicht um die halbe Welt reisen müssen. Und denken Sie daran, dass das Einzige, was man am Strand hinterlassen sollte, die eigenen Fußabdrücke im Sand sind.
Wenn Sie mögen, leiten Sie diese Wochenauslese gern weiter. Abonnieren können Sie sie übrigens hier. Und wenn Sie auch unsere Presseschau zu Umwelt- und Klimathemen lesen möchten, können Sie sich hier dafür anmelden – dann halten wir Sie montags bis freitags auf dem Laufenden. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!
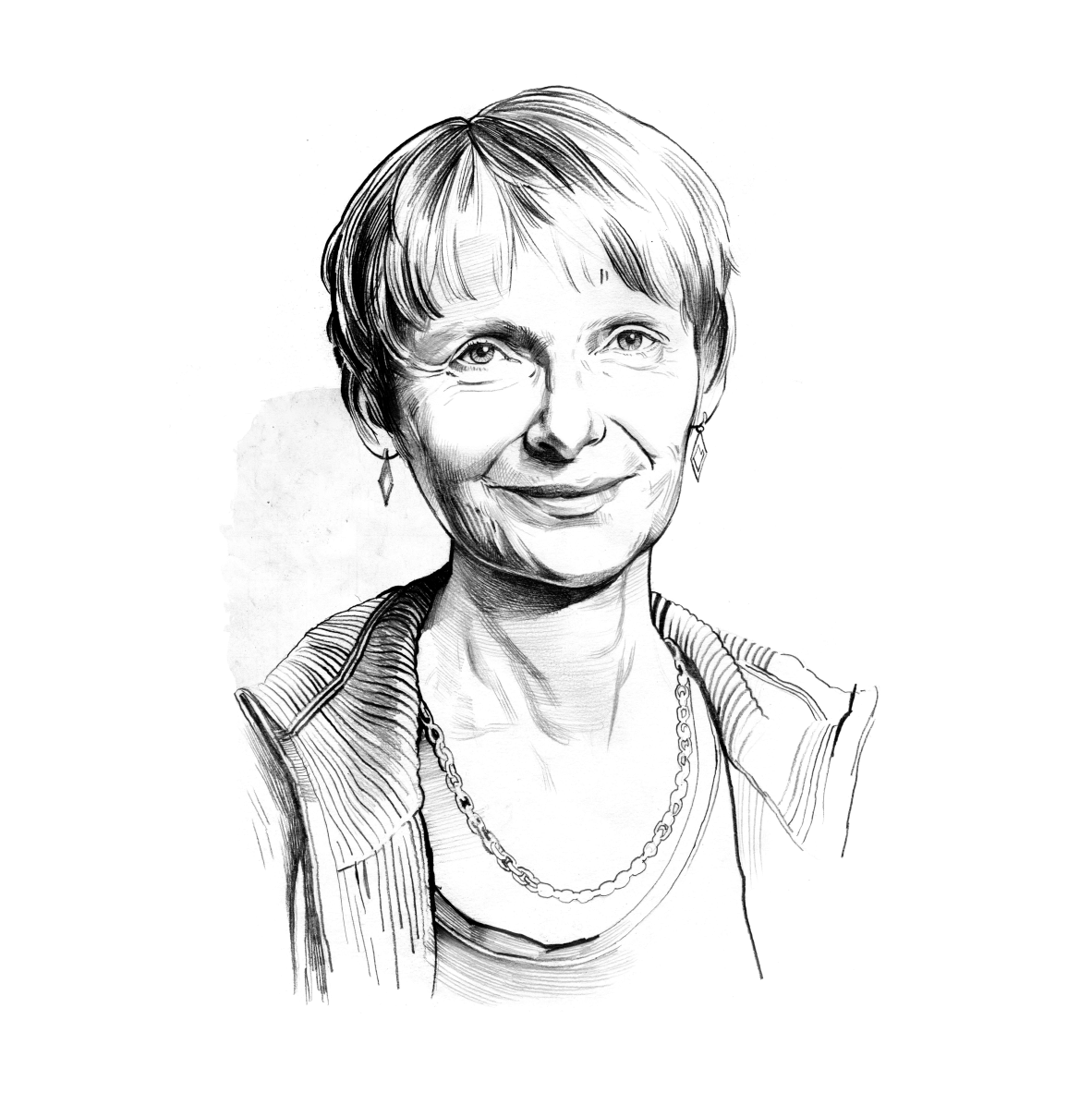
Kerstin Eitner
Redakteurin
AfD? Nee, oder?!
ich verstehe ja vieles nicht. Warum sind die im Kino angebotenen Snacks in ohrenbetäubend raschelnden Tüten verpackt? Was veranlasst Menschen, am Ende einer Rolltreppe abrupt stehenzubleiben und somit für Auffahrunfälle zu sorgen? Weshalb kacheln auf E-Scootern gern zwei Personen über Gehwege, und was soll das überhaupt mit diesen Lifestyle-Accessoires?
Aber mit solchen Kinkerlitzchen wollen wir uns heute nicht aufhalten, denn es gibt Phänomene ganz anderen Kalibers, die ich erst recht nicht verstehe. Da gab im April laut ARD-Deutschlandtrend eine relative Mehrheit von 44 Prozent meiner Landsleute zu Protokoll, es gehe ihnen beim Klimaschutz nicht schnell genug (gegenüber 27 Prozent, denen es zu schnell ging und 18 Prozent, die das Tempo genau richtig fanden). Zudem wurde Umwelt- und Klimaschutz als wichtigstes Problem genannt, um das sich die Politik kümmern solle.
Doch wehe, wenn es dann ans Eingemachte geht. Denn kurz darauf präsentierten Wirtschafts- und Bauministerium ihren Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz (GEG), heute besser bekannt als „Habecks Heizungs-Hammer“ (Bildzeitung und danach noch viele andere Medien), „Energie-Stasi“ (CDU) oder „Heizungsmassaker“ und „Verarmungsprogramm“ (AfD).
Mal ganz abgesehen davon, was wirklich drinstand im Gesetz, was schmerzlich fehlte (der soziale Ausgleich) oder wie es am Ende mal aussehen wird, die Ampel gab danach ein klägliches Bild ab. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) reagierte dünnhäutig und beleidigt, die FDP zelebrierte ihre Lieblingsrolle als regierungseigene Opposition und Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich, man kennt das, in sein inneres Schweigekloster zurückgezogen.
Und die Deutschen? Ließen die seit Längerem gesunkenen Umfragewerte für die Ampel weiter in den Keller rauschen und stürzten sich weinend in die Arme der AfD. Im ARD-Deutschlandtrend vom 1. Juni erreichte die Rechtsaußen-Partei in der Sonntagsfrage 18 Prozent und zog mit der SPD gleich. Wobei nur ein gutes Drittel der Befragten angab, aus Überzeugung für die AfD stimmen zu wollen, rund zwei Drittel hingegen aus Enttäuschung über andere Parteien.
Oder vielleicht doch eher aus Angst vor Veränderung? Vor Wohlstandseinbußen – Finger weg von meiner Heizung, meinem Auto, meinem Schnitzel, meiner Flugreise! Eine weitere repräsentative Umfrage im Auftrag der Zeit ergab Anfang Juni, dass 70 Prozent der Deutschen es begrüßen würden, wenn die Regierung das GEG fallenlassen würde. Die Klimakrise wedeln wir dann wohl am besten mit der Fliegenklatsche weg.
Irgendwie erinnert mich das an den kleinen Pepe aus „Asterix bei den Spaniern“, der, um seinen Willen zu bekommen, stets droht: „Ich halte jetzt die Luft an, bis mir etwas passiert.“ Den Denkzettel verpassen die Enttäuschten letztlich sich selbst. Denn was immer sie bei der AfD zu finden hoffen, der angeblich so wichtige Klima- und Umweltschutz, mit dem es vielen doch nicht schnell genug geht, ist bei ihr nicht im Angebot. Her mit den fossilen Energien und der Atomkraft, weg mit den lästigen Windrädern, das muss energiepolitisch reichen.
Die AfD ist eine vom Verfassungsschutz 2021 als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestufte Partei (die gerichtliche Auseinandersetzung darum läuft noch) mit mindestens einem juristisch beglaubigten Faschisten (Björn Höcke) in ihren Reihen, gegen den gerade Anklage wegen der mutmaßlichen Verwendung von Nazi-Vokabular erhoben wurde. Was die Partei sonst so vorhat: Die sofortige Einstellung jeglicher Unterstützung der Ukraine und Unterwerfung derselben unter die Herrschaft von Zar Putin. Abwehr alles und aller „Fremden“. Deutschland den Deutschen. Zurück in eine vermeintlich goldene Vergangenheit, die es so nie gab. Ist es das, was ein knappes Fünftel der Wahlberechtigten möchte? Die Fünfzigerjahre, bloß mit sozialen Medien?
CDU, CSU und Teile der Presse haben beim Höhenflug der Rechten mindestens so sehr mitgeholfen wie die Politik der Bundesregierung, schreibt Johannes Hillje in der Zeit. Das dürfte stimmen. Dass sich die Hinwendung zu einer Dagegen-Partei wie der AfD vermutlich auf die eine oder andere Art erklären lässt, macht die Sache aber nicht besser – und ich bin nicht gewillt, dafür Verständnis aufzubringen.
Ein wirksames Rezept für ein Gegengift mit Durchschlagskraft hat bislang niemand so richtig parat. Gutes Regieren, mehr Mut zur Wahrheit, und sei sie noch so schmerzlich, das Sprechen über den Elefanten im Raum, den allseits gefürchteten Verzicht – das alles ist bestimmt nicht verkehrt, aber ob es helfen würde?
Was mir auf Anhieb einleuchtet, ist der neue Aktionsschwerpunkt der „Letzten Generation“ (mit früheren Aktionen hatte ich zuweilen meine Schwierigkeiten): Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen sich in den nächsten Wochen besonders die Reichen vorknöpfen, und das mit gutem Grund – denn, so Samira El Ouassil im Spiegel: „Der durchschnittliche CO2-Ausstoß von Milliardären hat im Jahr 2018 8190 Tonnen pro Kopf betragen. Raten Sie mal, was der Pro-Kopf-Ausstoß weltweit beträgt. 5 Tonnen.“ Privatjets und Yachten spielen dabei eine besonders unrühmliche Rolle. Folgerichtig sind die Aktiven zum Auftakt nach Sylt gereist, womöglich mit dem 49-Euro-Ticket, haben sich Zugang zum örtlichen Flughafen verschafft und einen teuren Privatflieger mithilfe eines Feuerlöschers orange eingefärbt. Man darf sich für die nächste Zeit wohl auf weitere Farbspektakel dieser Art einstellen.
Wenn Sie mögen, leiten Sie diese Wochenauslese gern weiter. Abonnieren können Sie sie übrigens hier. Und wenn Sie auch unsere Presseschau zu Umwelt- und Klimathemen lesen möchten, können Sie sich hier dafür anmelden – dann halten wir Sie montags bis freitags auf dem Laufenden. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!
Schönes Wochenende, auch wenn Sie weder über eigenes Flugzeug noch Luxusyacht verfügen.
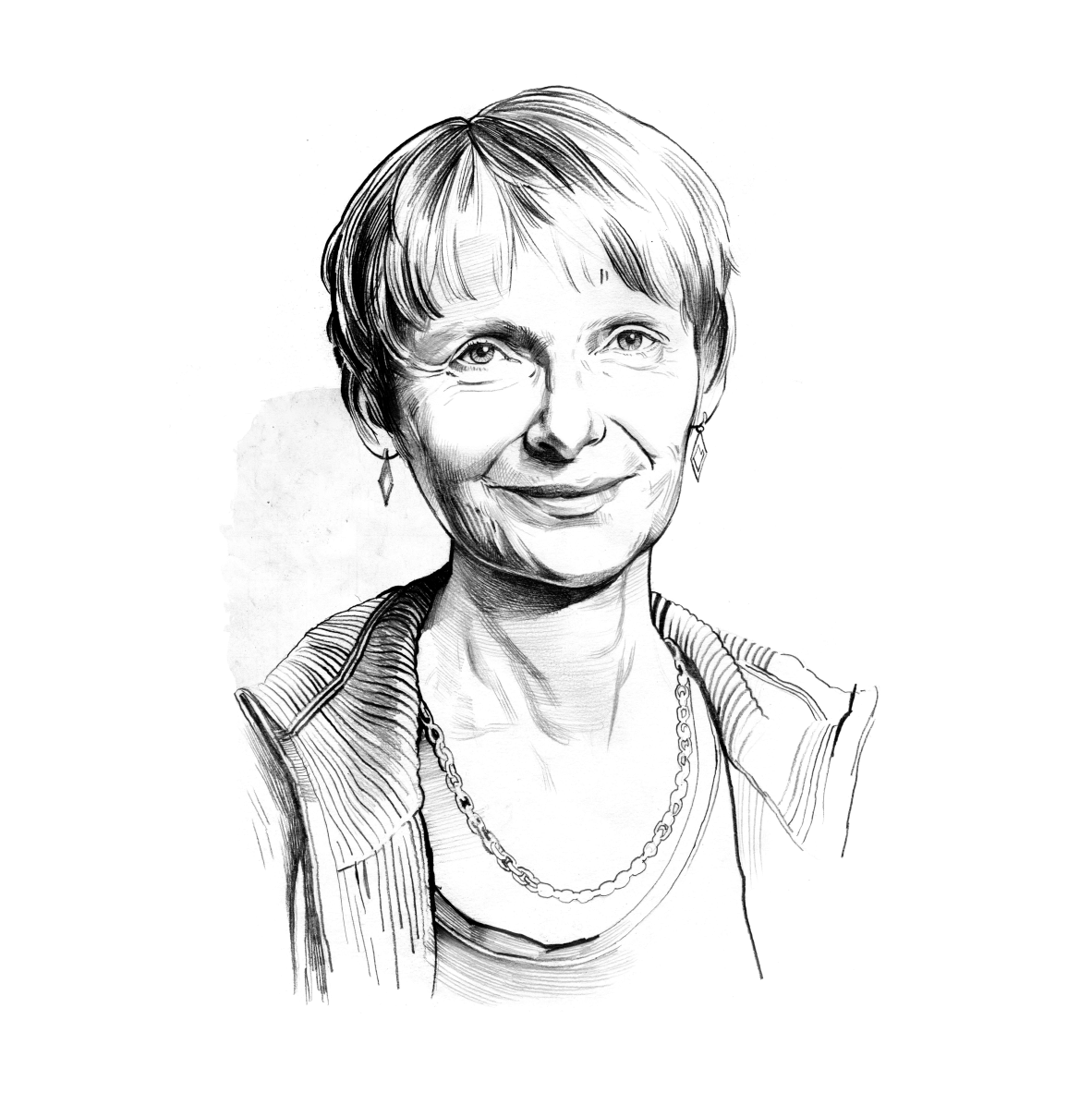
Kerstin Eitner
Redakteurin
Ausgebremst
Perspektivwechsel sind ja prinzipiell eine feine Sache, vor allem, wenn sie Resultat einer bewussten Entscheidung oder einer allmählichen Entwicklung sind. Mitunter vollziehen sie sich aber abrupt, ungeplant und schmerzhaft, und das nicht nur im übertragenen Sinne.
So ist es mir kürzlich ergangen. Etwas fegt mich von der ziemlich glatten und abgetretenen Stufe einer S-Bahn Treppe und lässt mich brutal auf den fiesen Steinboden knallen. Nachdem mich mein eigener und ein herbeigeeilter junger Mann aufgesammelt haben, dämmert mir, dass es mit dem geplanten Spaziergang bei Sonnenschein im Botanischen Garten wohl eher nichts wird – das linke Bein erweist sich als unbrauchbar. Lob und Preis dem hilfsbereiten jungen Mann und anderen netten Mitmenschen, denn während ich als Häufchen Unglück auf der Treppe hocke und auf den Rettungswagen warte, fragen mehrere Leute, ob wir Hilfe brauchen.
Dann das in solchen Fällen übliche Standardprogramm: Notaufnahme, warten, Röntgen, Diagnose (Oberschenkelhalsbruch), weitere Untersuchungen, Blutabnahme, Fragebögen, warten auf freies Zimmer, endlich ein Bett, warten auf die OP, leider bis zum nächsten Morgen. Sodann, statt hinaus zum 1. Mai, hinein zum 1. Mai, nämlich in den Operationssaal.
Die gute Nachricht: OP geglückt. Die schlechte: Bein etwa acht Wochen lang nur sparsam belasten, so die ärztliche Anweisung. Das Verlassen der im dritten Stock (ohne Fahrstuhl) gelegenen balkonlosen Wohnung wird zu einer sportlichen Herausforderung. Ich arbeite dran und mache Fortschritte, wobei „Schritte“ durchaus wörtlich gemeint ist. Unterstützung bietet mein Fuhrpark, bestehend aus zwei (!) Rollstühlen, einer davon eine Privatleihgabe, und einem segensreichen Rollator, auf dem man sogar Dinge von A nach B transportieren kann.
Acht Wochen, das klingt zwar wie eine Ewigkeit, ist aber in Wirklichkeit ein überschaubarer Zeitraum. Wie aber, Achtung, Perspektivwechsel, meistert man seinen Alltag, wenn man dauerhaft auf den Rollstuhl angewiesen ist, der sogenannte öffentliche Raum sowie der Nah- und Fernverkehr aber immer wieder schier unüberwindliche Hindernisse bereithalten? Theoretisch hätte zwar „für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit“ erreicht werden sollen. So will es das Personenbeförderungsgesetz, aber dem ist leider nicht so.
Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) belegt das in seinem Bahntest 2023/2024, in dem es nicht nur um die Bahn geht, eindrucksvoll. Es fängt schon mit dem Zugang zu Informationen und Tickets an. Weiter geht es (oder eben nicht) mit dem Weg zur nächsten Haltestelle und dem Zugang zu derselben. Zitat aus der besagten VCD-Studie: „Nicht abgesenkte Bordsteine, unbefestigte und unebene Wege, schlechter Straßenbelag, lose Gehwegplatten, steile Rampen, im Weg stehende Pfosten und Poller, fehlende Querungshilfen an breiten Straßen, zu kurze Grünphasen, keine taktilen und akustischen Hilfen an Ampeln, schlechte Beleuchtung…“
Während es bei den Fahrzeugen, also Bussen oder Straßenbahnen, nicht so schlecht aussieht, heißt es in Bahnhöfen oft: Vorsicht an der Bahnsteigkante. Deren Höhe variiert nämlich in Deutschland zwischen weniger als 38 und sagenhaften 103 Zentimetern. Wer im Rollstuhl sitzt und die Bahn benutzen will, kann das zudem nicht spontan tun, sondern muss sich zuvor zwecks Bedienung der umständlich zu handhabenden Zustiegshilfen an den bahneigenen Mobilitätsservice wenden und dann hoffen, dass es klappt. Was da so alles schieflaufen kann, zeigt das Beispiel der Umweltaktivistin und Rollstuhlfahrerin Cécile Lecomte.
Was es braucht, damit es besser läuft: mehr Geld, mehr Personal, mehr Beteiligung von Betroffenen, klare Standards und Verantwortlichkeiten zum Beispiel. Sowie die Einsicht, dass es nicht „nur“ um ein paar Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer geht, sondern auch um Reisende mit schwerem Gepäck oder Fahrrädern, Eltern mit Kinderwagen, Menschen mit Einkaufstrolleys, Kinder und Alte. Es betrifft also in Wirklichkeit sehr viele. Und war es nicht das hehre Ziel, ÖPNV und Bahn schon aus Klimaschutzgründen attraktiver zu machen? Dazu zählt ganz unbedingt auch die Barrierefreiheit. Am besten 100 Prozent.
Wenn Sie mögen, leiten Sie diese Wochenauslese gern weiter. Abonnieren können Sie sie übrigens hier. Und wenn Sie auch unsere Presseschau zu Umwelt- und Klimathemen lesen möchten, können Sie sich hier dafür anmelden – dann halten wir Sie montags bis freitags auf dem Laufenden. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!
Schönes Wochenende und Vorsicht beim Treppensteigen!
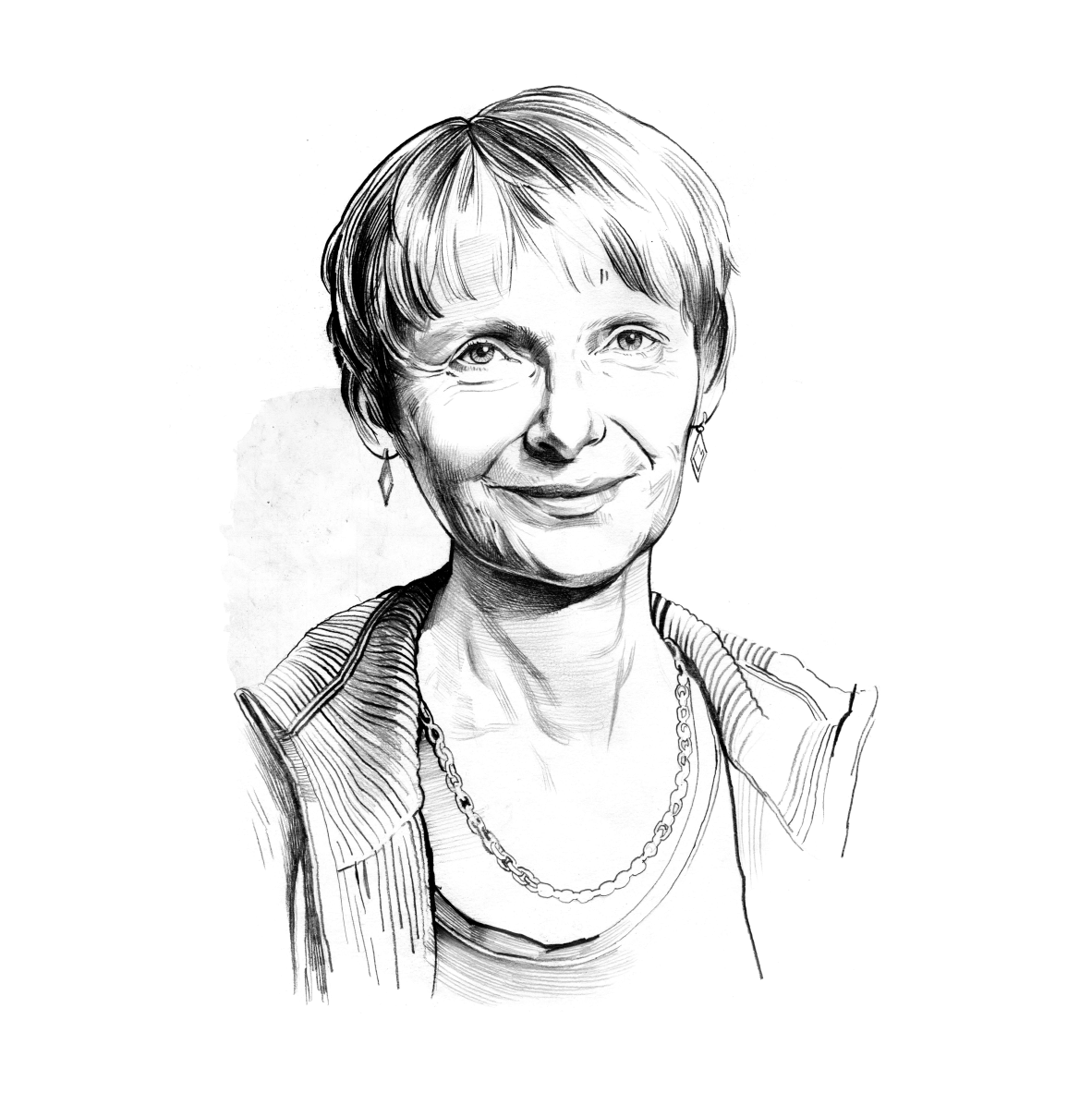
Kerstin Eitner
Redakteurin
Bedenklicher Pegel
wenn man den einstmals viertgrößten See der Erde im Internet sucht, findet man nur mehr ein paar Pfützen: „Der Aralsee“, heißt es bei Wikipedia, „war ein großer, abflussloser Salzsee in Zentralasien. Durch lang andauernde Austrocknung zerfiel der See um die Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert in mehrere, erheblich kleinere Teile.“ Die Verlandung, man könnte auch sagen, Verwüstung des Aralsees gilt als „eine der größten vom Menschen verursachten Umweltkatastrophen“.
Zwei Flüsse speisten einst den See. Dann beschloss Josef Stalin, in den Wüsten Kasachstans und Usbekistans solle Baumwolle wachsen. Baumwolle aber ist durstig, sie braucht viel Wasser. Der Anfang vom Ende des Aralsees. Nun könnte man meinen, die Überreste dieses ehedem gewaltigen Binnenmeers befänden sich weit weg. Auch der stark schrumpfende Tschadsee liegt nicht gerade um die Ecke. Oder der Urmiasee im Iran. Oder der Poopó-See in Bolivien. Nie gehört?
Den Gardasee aber kennen wir alle.
„Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo man der globalen Wasserkrise entkommen kann“
Seit Monaten verfolgt halb Europa das Schicksal von Italiens größtem See. Sein Pegelstand ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht um diese Jahreszeit. Denn in den Alpen hat es im Winter erneut viel zu wenig geschneit. Dem Lago – und der gesamten Po-Ebene – fehlt Schmelzwasser. Auch wenn der Tourismusverband diese Woche Entwarnung gab: So dramatisch wie berichtet, sei die Lage nicht, weder Fährverkehr noch Badebetrieb seien beeinträchtigt und das Austrocknen des Sees stehe schon gar nicht bevor. Es bleibt der Eindruck, dass Wassermangel nicht länger ein Problem zentralasiatischer Steppen oder des „Globalen Südens“ ist.
„Uns beginnt zu dämmern, dass es keinen Ort auf der Welt gibt, wo man der globalen Wasserkrise entkommen kann“, sagt Maude Barlow im neuen Greenpeace Magazin, das heute die Kioske und Briefkästen erreicht. Die 75-jährige Kanadierin hat 2010 das Menschenrecht auf Wasser mit erstritten und erklärte mir im Interview für unsere Ausgabe „Bis zum letzten Tropfen“ unter anderem, warum nutzbares Süßwasser – so wie die Menschheit damit umspringt – eben doch endlich ist und warum Wasser in die öffentliche Hand gehört.
Während meine Kollegin Frauke Ladleif, unser Bildredakteur Peter Lindhorst und ich dieses Heft planten, wurde das Thema Wasser aktueller, als es uns lieb sein kann. Europa lernte das neue Wort „Winterdürre“, in Frankreich brachen offene Verteilungskonflikte um Grundwasser aus, in New York endete die Weltwasserkonferenz der Vereinten Nationen mit Hunderten freiwilligen Selbstverpflichtungen – und dann war da auch noch das katastrophale Erdbeben in der Türkei und Nordsyrien.
„Diesem Fluss droht der Infarkt“
Unser Autor Bartholomäus Laffert und die Fotografin Sitara Thalia Ambrosio reisten nur Tage nach dem Beben in den Nordosten Syriens, um eine andere Krise zu recherchieren: Dieser Landstrich verdorrt. Und Schuld ist nicht allein die Klimakrise, sondern auch das Nachbarland Türkei. Ankara drosselt den Zufluss des Euphrat in die kurdische Region immer weiter. Laffert und Ambrosio beschreiben in ihrer Reportage, wie Wasser auch eine Waffe sein kann, nachzulesen in unserer neuen Ausgabe.
Außerdem erläutert die Juristin Susanne Schmeier Frauke Ladleif, wie das Ringen um die kostbarste aller Ressourcen sich im Moment auf die globale Sicherheitslage auswirkt. Wir stellen die bunt sprudelnden Ideen und Aktionen von Graswurzelbewegungen zur Wassergerechtigkeit vor und verweilen eine opulente Fotoreportage lang am Snake River in den USA, wo die eigentlich als ökologisch geltende Wasserkraft dem indigenen Leben im und am Fluss zu schaffen macht und Staudämme hoch umstritten sind. Ein Herzinfarkt drohe dem Fluss, sagt ein Vertreter des Stammes der Nez Perce. Hayley Austin, gebürtige Texanerin und heute Wahlhamburgerin, hat diese Geschichte nicht nur fotografiert, sondern auch viele Interviews mitgebracht.
Zu guter Letzt blicken wir auf Deutschlands einzige Metropole. Die Millionenstadt Berlin liegt ausgerechnet in jenem Teil des Landes, der zunehmend trockener wird. Fred Grimm hat die Zukunftsoptionen der Hauptstadt erkundet, während das Bundeskabinett Deutschlands erste nationale Wasserstrategie beriet.
Von Auenwald bis Wasserrecycling reichen mögliche Lösungen, die wir Ihnen wie gewohnt zum Schluss einschenken. Wie so oft bedarf es dafür nicht unbedingt teurer Technik. Die Natur könnte vieles selbst – und sogar am besten – in Ordnung bringen, wenn wir sie nur ließen.
Im Teil 2 der aktuellen Ausgabe beantworten wir, was das historische Abkommen der Weltnaturkonferenz vom Dezember für Deutschland bedeutet. Wir beleuchten die Lage der Olivenhaine in Italien, rechnen kurz durch, was Ihr Auto Sie (und die Allgemeinheit) WIRKLICH kostet und erkunden die obskuren Flugrouten von Fledermäusen, die ja bekanntlich eher Nachteulen sind.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem neuen Greenpeace Magazin, das Sie – falls Sie uns noch nicht abonnieren – im gut sortierten Bahnhofsbuchhandel oder hier erstehen können.
Wenn Sie mögen, leiten Sie diese Wochenauslese gern weiter. Abonnieren können Sie sie übrigens hier. Und wenn Sie auch unsere Presseschau zu Umwelt- und Klimathemen lesen möchten, können Sie sich hier dafür anmelden – dann halten wir Sie montags bis freitags auf dem Laufenden. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!
Herzliche Grüße aus der Redaktion!
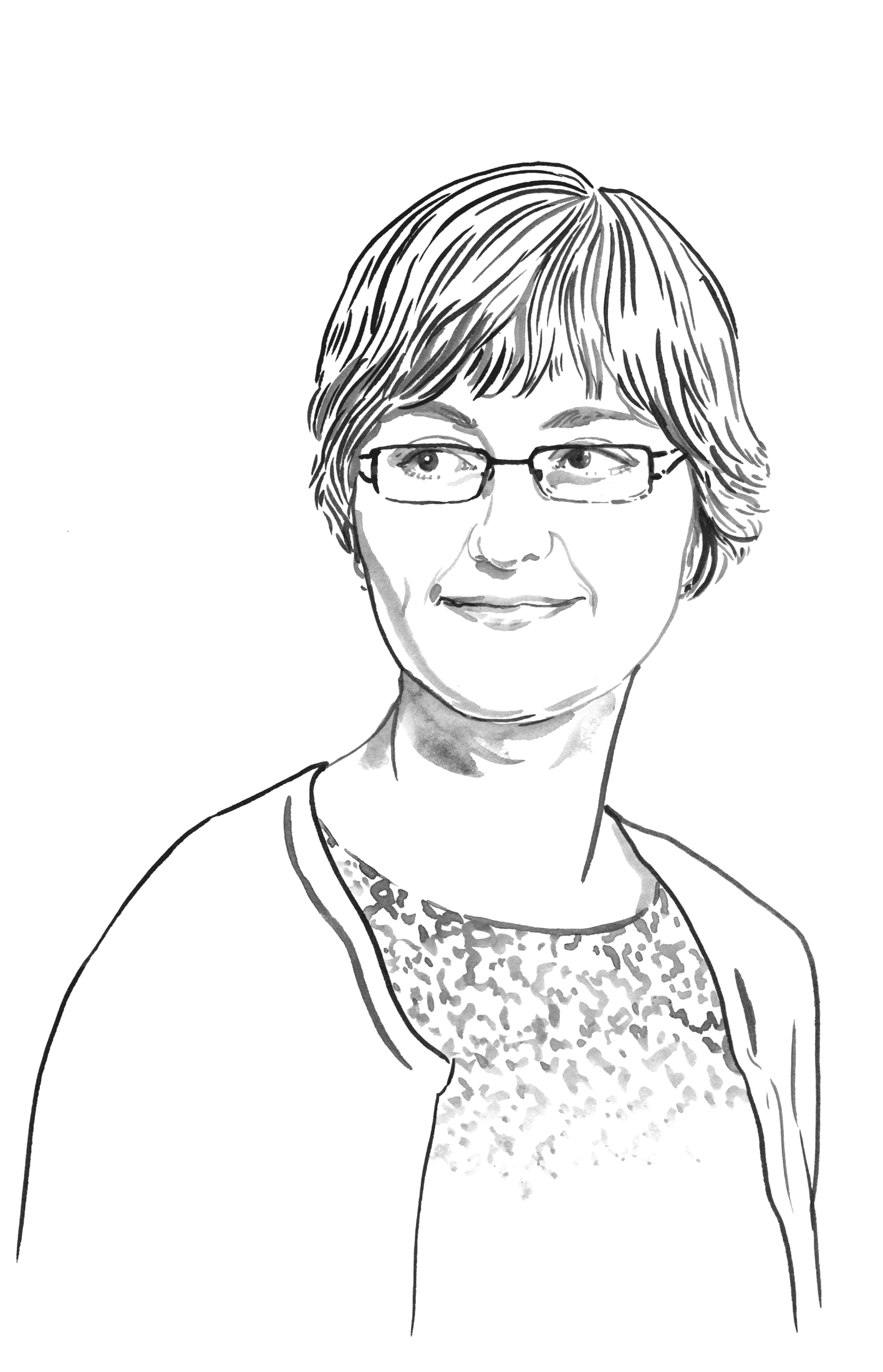

Katja Morgenthaler
Redakteurin
Blütenträume
da kann der Frühling sich noch so zieren, selbst von Kaltlufttropfen, kräftigem Ostwind, Regen- und späten Schneefällen lassen sich Blumen und Bäume auf Dauer nicht abschrecken und beschließen trotzig: Ich blühe jetzt! Und so spaziert der winterblasse Mensch durch Wiesen, Parks oder Botanische Gärten und freut sich wie jedes Jahr darüber, dass die Blüten nach und nach alle herauskommen, erst Schneeglöckchen, dann Krokus, Tulpe, Narzisse, Schlüsselblume und ein paar Stockwerke höher Weide, Kornelkirsche, Pflaume, Magnolie…
Die weitaus meisten von ihnen haben übrigens einen Migrationshintergrund, sind aber mittlerweile Alteingesessene. Die Tulpe zum Beispiel stammt nicht aus den Niederlanden, sondern aus Mittel- und Zentralasien. Käme jemand auf die Idee, diese Einwanderinnen ausweisen zu wollen, hätte das eine Verödung unserer Landschaften und Gärten zur Folge; bei Obst und Gemüse würde es den Speisezettel treffen.
Aber wer könnte so was auch wollen, es sei denn, wir haben es mit invasiven Arten zu tun. Riesenbärenklau, Drüsiges Springkraut, Wechselblatt-Wasserpest und wie sie alle heißen sind in unseren Breiten nicht gern gesehen. Mit Staunen erfährt man, dass die weltweiten wirtschaftlichen Schäden durch Neobiota, wie zugereiste Pflanzen und Tiere auch genannt werden, nur von den Verheerungen übertroffen werden, die Stürme anrichten – womit Flora und Fauna noch vor Erdbeben, Überflutungen, Dürren, Waldbränden und anderen Naturkatastrophen liegen.
Andererseits: Gerade kommt das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut mit einer Studie um die Ecke, die Klimakrise und Artensterben untersucht und noch einmal darauf hinweist, dass sich beides gegenseitig beeinflusst. Bezogen auf die Biomasse seien bereits vier Fünftel der natürlich vorkommenden Säugetiere und die Hälfte der Pflanzen verschwunden, ganz ohne Ausweisungsbeschluss.
In Mannheim dürfte davon auf den ersten Blick nichts zu merken sein. Die dort am letzten Freitag eröffnete Bundesgartenschau (BUGA) verzeichnete jedenfalls gleich am ersten Tag einen Besucherrekord. Sie hat sich einiges vorgenommen – nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Kritik an Naturzerstörungen durch solche Leistungsschauen gegeben hatte, will diese nun „die nachhaltigste BUGA aller Zeiten werden“ und „Umwelt- und Klimaschutz, ressourcenschonende Energiegewinnung und nachhaltige Nahrungsmittelsicherung“ thematisieren.
Das klingt löblich, denn kaum ist man, noch ganz beschwingt, vom Spaziergang zurück, da wird man von einem Strauß beunruhigender Nachrichten begrüßt: Die Menge an ausgestoßenen Treibhausgasen war letztes Jahr höher denn je, Europa erwärmt sich schneller als jeder andere Kontinent, Deutschland hat seine Emissionsziele verfehlt, der Expertenrat für Klimafragen macht als Hauptverantwortliche dafür, wir ahnten es schon, den Gebäude- und den Verkehrsbereich aus...
Man sollte meinen, da wäre schnelles und entschlossenes Handeln seitens der Politik gefragt, doch diese treibt derzeit seltsame Blüten. Die in Berlin regierende „Fortschrittskoalition“ unterbricht kurz ihr Gezänk über den Heizungstausch bis zur Wiedervorlage (hat man je in einem Frühjahr so viel über das Heizen geredet?), will weiterhin die Sektorziele aufweichen, kein Sofortprogramm für den Verkehrsbereich auflegen und dafür sogar das Klimaschutzgesetz ändern. Der Expertenrat zeigt sich irritiert, Umweltverbände sind empört und prüfen Klagemöglichkeiten.
Hören Sie das auch? Tick. Tick. Tick. Schnell raus, solange da noch was wächst. Im Park, im Wald, im eigenen oder im Kleingarten; von mir aus fahren Sie nach Mannheim, wenn nicht gerade Bahnstreik ist. Klar, bei Sonne ist es herrlich. Aber eigentlich ist Regen besser, nicht nur für die Pflanzen. Freuen wir uns über jeden Tropfen. Heiß und trocken wird es noch früh genug.
Wenn Sie mögen, leiten Sie diese Wochenauslese gerne weiter. Abonnieren können Sie sie übrigens hier. Wenn Sie auch gerne unsere Presseschau zu Umwelt- und Klimaschutzthemen zugeschickt bekommen wollen, sollten Sie sich hier dafür eintragen – dann halten wir Sie montags bis freitags auf dem Laufenden. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!
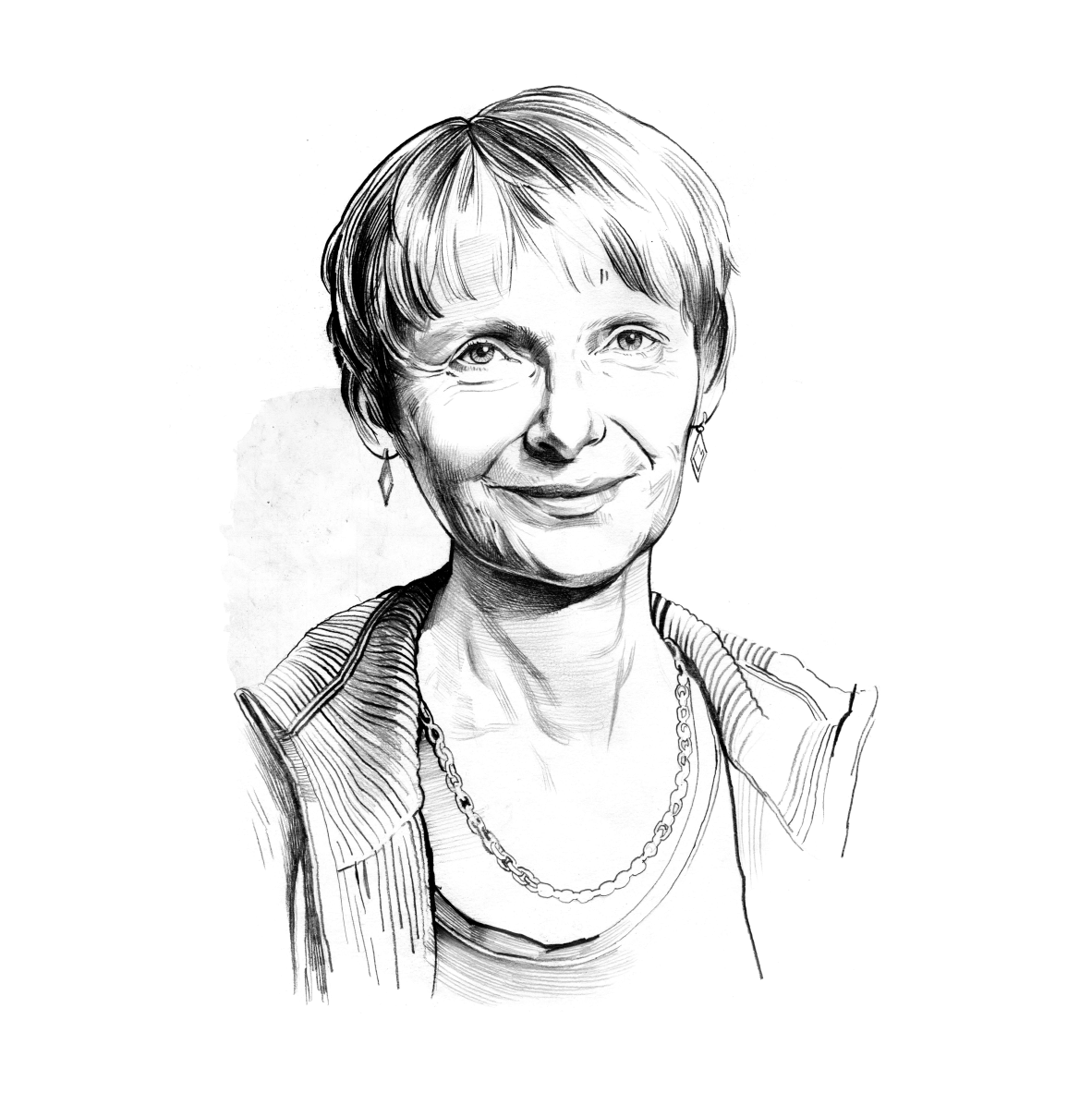
Kerstin Eitner
Redakteurin
Abschied vom Atom (?)
noch hört man nichts, aber schließlich sind es ja auch noch drei Wochen, bis die Ära der Stromerzeugung aus Atomkraft in Deutschland endgültig vorbei sein soll. Also praktisch eine Ewigkeit. Seit der Kehrtwende des Verkehrsministers beim auf EU-Ebene geplanten und eigentlich vereinbarten Aus für Verbrennungsmotoren wissen wir zweierlei: Erstens, man kann auch ein paar Sekunden vor zwölf ein vermeintlich fest verplombtes Fass noch einmal aufmachen. Und zweitens, in der Ampel sind manche so technologieoffen, dass sich diese Haltung auch auf Technologien von gestern und vorgestern erstreckt.
Die Atomkraft galt nämlich in der Bundesrepublik (wie auch in der DDR) ab den Fünfzigerjahren als tolle Zukunftsenergie. Unter Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) wurde das Bundesministerium für Atomfragen, BMAt, gegründet, dessen erster Minister Franz Josef Strauß (CSU) hieß. Besagtes BMAt war übrigens der Vorläufer des späteren Ministeriums für Bildung und Forschung. Proteste gab es zunächst keine, weder in der DDR noch im Westen, wo parteiübergreifend Einigkeit herrschte, dass die „friedliche Nutzung der Kernenergie“ eine feine Sache sei.
In den Siebzigerjahren begann sich im Westen das Blatt allmählich zu wenden. Die Chiffren für ein erst langsam, dann immer schneller wachsendes Protestpotenzial lauteten Wyhl und Gorleben, Kalkar und Wackersdorf, Brokdorf und Grohnde. Und die Reaktorunfälle von Three Mile Island im US-Bundesstaat Pennsylvania (1978) und dem ukrainischen Tschernobyl in der damaligen Sowjetunion (1986) taten ein Übriges. Dann gab es unter der rot-grünen Regierung einen Atomausstieg, unter der schwarz-gelben einen kurzen Wiedereinstieg und nach der bislang letzten Kastastrophe im japanischen Fukushima (2011) den fast endgültigen Ausstieg, an den noch mal dreieinhalb Monate „Streckbetrieb“ angehängt wurden.
Eine ganz so feine Sache schien die friedliche Nutzung der Kernenergie wohl doch nicht zu sein, und überhaupt: Was heißt hier friedlich? Plutonium, der Stoff, aus dem die Bomben sind, entsteht bei der Kernspaltung immer, auch in Leistungsreaktoren. Zwar nicht in bester, reiner Waffenqualität, aber auch daraus lassen sich nukleare Sprengsätze herstellen. Und dass solche Anlagen sich als Terror- oder Kriegsziele eignen oder zumindest für den Aufbau einer Drohkulisse, zeigt sich immer wieder am Beispiel des ukrainischen AKW Saporischschja.
Es gibt viele Gründe, Laufzeitverlängerungswünschen eine Absage zu erteilen. Sicherheitsbedenken zum Beispiel. In den 56 französischen Kraftwerken etwa, darunter 13 betagte Ü-40-Anlagen, häufen sich die Probleme – gerade erst wurden in drei Blöcken neue Risse in den Rohrleitungen entdeckt. Schweißnähte wollen überprüft werden, im Reaktordruckbehälter können im Lauf der Zeit durch die fortgesetzte Neutronenstrahlung sogenannte Sprödbrüche auftreten, und dann sorgt anhaltende Dürre für niedrige Pegelstände in den Flüssen wie im letzten Sommer, sodass es eng wird beim Kühlwasser. Nichtsdestotrotz sollen die AKW in Frankreich unter Auflagen bis zu 50 Jahre laufen dürfen. Es sind sogar Laufzeitverlängerungen auf 60 oder 80 Jahre im Gespräch.
Und die Klimakrise? Gerade hat der Weltklimarat uns wieder mal die Leviten gelesen. Müssen wir nicht nach jedem noch so kleinen Strohhalm greifen, und wenn er radioaktiv strahlt, um wenigstens noch in die Nähe einer Erderhitzung um „nur“ zwei Grad zu gelangen? Wenn wir mal Uranabbau und -anreicherung, Brennelementfertigung, Transporte, Rückbau und Endlagerung beiseitelassen und nur den laufenden tatsächlich CO2-freien Betrieb betrachten, dann müssten, um bis 2050 elf Prozent des weltweiten Strombedarfs zu decken (das Maximum dessen, was die Internationale Atomenergiebehörde IAEA derzeit für realistisch hält), jedes Jahr rund dreimal so viele Reaktoren ans Netz gehen wie bisher.
Das würde erstens viel zu lange dauern und zweitens eine Kleinigkeit kosten. Abschreckende Beispiele: die Druckwasserreaktoren neuen Typs (EPR) im französischen Flamanville oder Hinkley Point C im britischen Somerset, die beim französischen Stromriesen EDF als Bauherren erhebliches Bauchgrimmen verursachen, Stichwort: explodierende Kosten und erodierende Zeitpläne. Wenn bei solchen Projekten nicht der Staat einspringt, also Sie und ich und wir alle, dann wird das nichts. Wir zahlen sowieso drauf, auch für etwaige Unfälle (Atomanlagen sind selbstverständlich nicht vollkaskoversichert) und natürlich für die Endlagerung. Das Geld wäre in echten Zukunftsenergien weitaus besser angelegt.
Ich bin gespannt, ob die ganze Diskussion vor dem 15. April noch mal losbricht oder ob wir das Abschaltdatum jetzt ohne solche Hintergrundgeräusche erreichen. Mit der Zeitumstellung morgen Nacht sind wir schon wieder eine Stunde näher dran. Das hoffentlich letzte Wort soll der Dichter Eugen Roth haben, der die ganze Sache viel besser zusammenfasst als ich es je könnte.
Das Böse
Ein Mensch, was noch ganz ungefährlich
Erklärt die Quanten (schwer erklärlich!)
Ein zweiter, der das All durchspäht,
erforscht die Relativität.
Ein dritter nimmt noch harmlos an,
Geheimnis stecke im Uran.
Ein vierter ist nicht fernzuhalten,
von dem Gedanken, Kern zu spalten.
Ein fünfter – reine Wissenschaft –
Entfesselt der Atome Kraft.
Ein sechster, auch noch bonafidlich,
will die verwerten, doch nur friedlich.
Unschuldig wirken sie zusammen :
Wen dürften, einzeln, wir verdammen?
Ist‘s nicht der siebte erst und achte,
Der Bomben dachte und dann machte?
Ist‘s nicht der Böseste der Bösen,
der es gewagt sie auszulösen?
Den Teufel wird man nie erwischen:
Er steckt von Anfang an dazwischen.
Wenn Sie mögen, leiten Sie diese Wochenauslese gerne weiter. Abonnieren können Sie sie übrigens hier. Wenn Sie auch gerne unsere Presseschau zu Umwelt- und Klimaschutzthemen zugeschickt bekommen wollen, sollten Sie sich hier dafür eintragen – dann halten wir Sie montags bis freitags auf dem Laufenden. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!
P.S.: Wegen der anstehenden Produktion des nächsten Greenpeace Magazins sowie dem Karfreitag pausiert die Wochenauslese für zwei Wochen. Am 14. April sind wir wieder da!
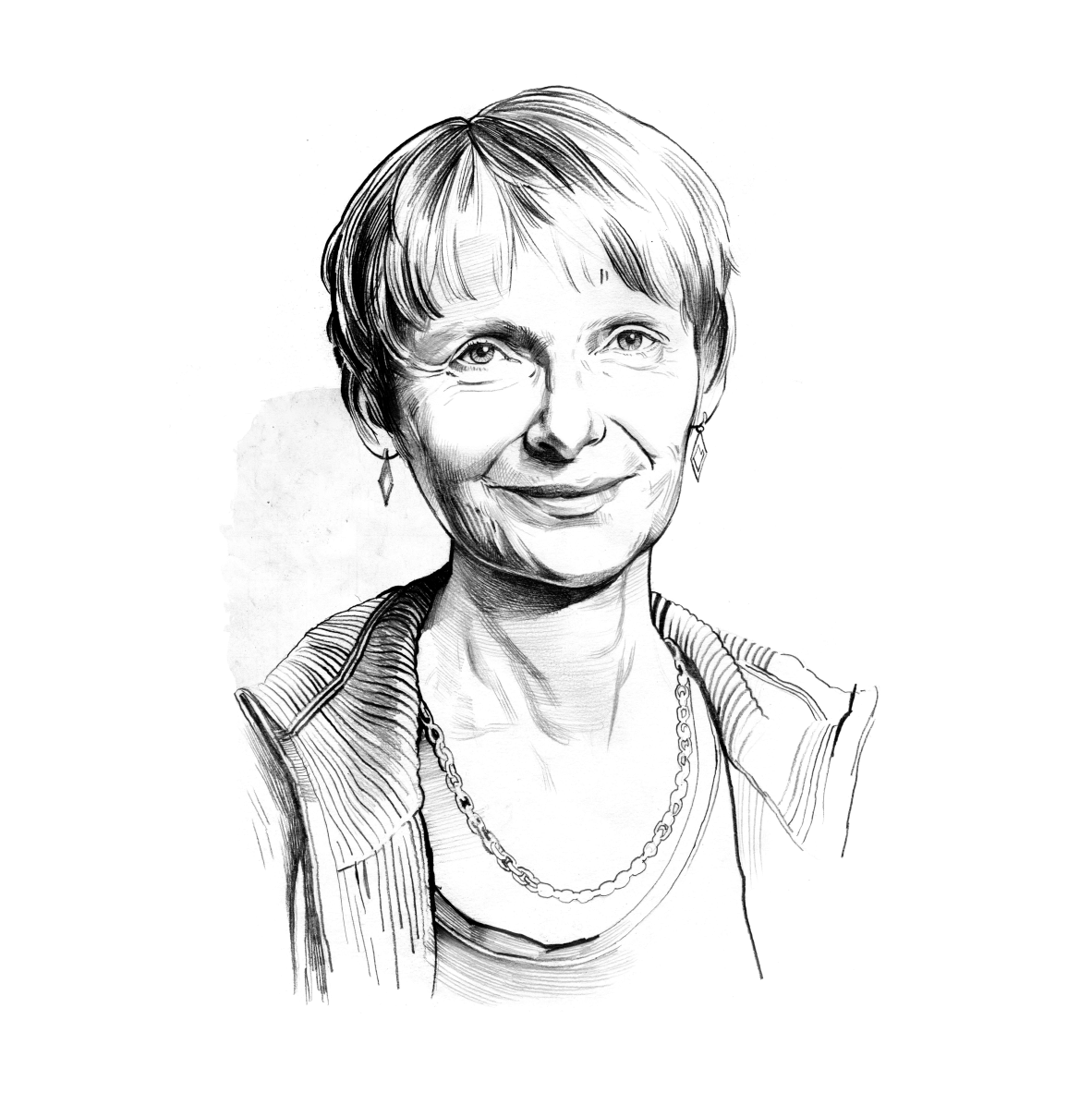
Kerstin Eitner
Redakteurin
Wüstenwinter
an den letzten Hitzesommer können Sie sich sicher erinnern, aber an eine Winterdürre? Schon das Wort klingt ja so paradox wie, sagen wir, klimaneutraler Verbrennungsmotor. Während wir in diesen Tagen in der Redaktion an unserer nächsten Ausgabe zum Thema Wasser arbeiten, breitet sich in Europa eine unheimliche Trockenheit aus – es hat einfach zu wenig geregnet und geschneit. In Italien ist der Po an manchen Stellen zu einem Rinnsal geronnen, und nach San Biagio, einer kleinen Insel auf dem Gardasee, kommt man nun trockenen Fußes auch ohne Boot. In Frankreich müssen manche Gemeinden mit Wasser vom Tankwagen versorgt werden, und wer es wagt, sein Auto zu waschen oder Blumen zu gießen, muss mit Strafen rechnen – immerhin klingt der Wüstenwinter auf Französisch etwas schöner: Sécheresse hivernale.
Der Hotspot aber ist Barcelona: Dort herrschen gerade Temperaturen über dreißig Grad, Stauseen verdunsten zu Ödland, sodass die Fundamente und der Kirchturm einer überfluteten Ortschaft geisterhaft wieder auftauchen wie eine antike, versunkene Stadt. Die nach der letzten Dürre vor 15 Jahren errichteten Meerwasserentsalzungsanlagen laufen auf Volllast – trotzdem werden sie einen fortbestehenden Mangel nicht ausgleichen können. Und der heiße Mittelmeersommer steht erst noch bevor.
Das Trinkwasserschloss bröckelt
In der Wissenschaft spricht man schon vom peak water – demnach steuert der Kontinent auf einen Kipppunkt zu, nach dem die Süßwasserreserven nur noch abnehmen. Schuld ist das Abschmelzen der Alpengletscher, das „Trinkwasserschloss Europas“, das große europäische Ströme wie Donau und Rhone speist. Bis 2100 könnten zwei Drittel dieser Gletscher im Gebirge verschwunden sein, selbst wenn wir die Klimaziele einhalten.
In Deutschland wird es zwar zu dramatischen Szenarien wie in Südeuropa wohl erstmal nicht kommen. Trotzdem spricht Andreas Marx, der im Helmholtzzentrum für Umweltforschung die Daten des Dürremonitors koordiniert, von einem „totalen Wahnsinn“. Denn der Rheinpegel sank Anfang des Monats wieder seinem gruseligen August-Niveau entgegen, genau wie die Grundwasserspiegel an vielen Orten im Osten. Pünktlich dazu hat die Bundesregierung am Mittwoch ihre Nationale Wasserstrategie verabschiedet – 78 Maßnahmen, „um Mangellagen vorzubeugen“, sagte die grüne Umweltministerin Steffi Lemke bei der Vorstellung des Papiers. Die sehen vor allem einen strengeren Gewässerschutz vor, wassersensible Stadtentwicklung – Stichwort Schwammstadt – und Landwirtschaft, außerdem sollen bei Knappheit Prioritäten der Wasserverteilung gesetzt werden.
Wasser für Coca-Cola und Aldi
Hehre Ziele, nur bleibt einiges unkonkret: So stand im Ursprungsentwurf des Konzepts noch der Passus, dass nur so viel Grundwasser entnommen werden soll, wie sich neu bilden kann. Und bei einem Wassernotstand stünde nicht nur die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger ganz vorne, sondern womöglich gleichrangig die der Lebensmittelwirtschaft – und damit theoretisch auch der Bedarf von Coca-Cola oder der Fleischindustrie. Lemke selbst räumt „potenzielle Nutzungskonflikte“ ein, die ihre Strategie doch eigentlich verhindern sollte. Die Konflikte müssen die Menschen vor Ort wohl künftig selbst mit den Konzernen austragen, wenn es um das kostbare Nass geht – eindeutige Versorgungssicherheit, wie sie der Städte- und Gemeindebund fordert, ergibt sich aus der Nationalen Wasserstrategie nicht. Dazu passt dann auch, dass sich Aldi Nord, das inzwischen in Bayern selbst Grundwasser anzapft und in Plastikflaschen verkauft, kürzlich als „Grundversorger“ bezeichnete. Vielleicht müssen die Leute also bald zum Discounter, wenn aus dem Hahn nichts Trinkbares mehr kommt.
Viel wäre wohl schon getan, wenn man bei den größten Wassernutzern ansetzen würde: Denn das sind nicht die Privathaushalte, sondern Energiekonzerne. Für die Kühlung der Atom-, Kohle- und Gaskraftwerke beanspruchen sie die Hälfte des deutschen Wasserverbrauchs. Und auch die Landwirtschaft könnte mit gezielter Bewässerung, etwa durch das Tröpfchenverfahren, große Mengen einsparen. Und dann haben wir noch gar nicht über die globalen Auswirkungen unseres Wasserkonsums gesprochen: Direkt mag eine Person in Deutschland um die 120 Liter Wasser am Tag verbrauchen. Doch in die Herstellung unserer Alltagsprodukte vom Kaffee bis zum Smartphone fließen anderswo auf der Welt zum Teil tausende Liter mehr – unser Wasserfussabdruck.
Klimaschutz ist Wasserschutz
Pläne wie die Nationale Wasserstrategie sollen das Land darauf vorbereiten, sich an die Folgen der Klimakrise anzupassen. Wie gut das gelingt, hängt vor allem vom weiteren Ausmaß der Erderhitzung ab – und das können wir jetzt noch aktiv begrenzen. Wer sich also noch immer gegen ein Tempolimit, gegen das Ende des Verbrennungsmotors (immerhin erst ab 2035!) und gegen den Einbau klimafreundlicher Wärmepumpen statt fossiler Gasheizungen stemmt, nimmt heute schon existenzielle Verteilungskämpfe in der Zukunft in Kauf. Klimaschutz ist also auch Wasserschutz, beides braucht rasches Handeln und einen Plan – darauf ein stilles Sebstgezapftes aus dem Hahn!
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!
Wenn Sie mögen, leiten Sie diese Wochenauslese gerne weiter. Abonnieren können Sie sie übrigens hier. Wenn Sie auch gerne unsere Presseschau zu Umwelt- und Klimaschutzthemen zugeschickt bekommen wollen, sollten Sie sich hier dafür eintragen – dann halten wir Sie montags bis freitags auf dem Laufenden. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!
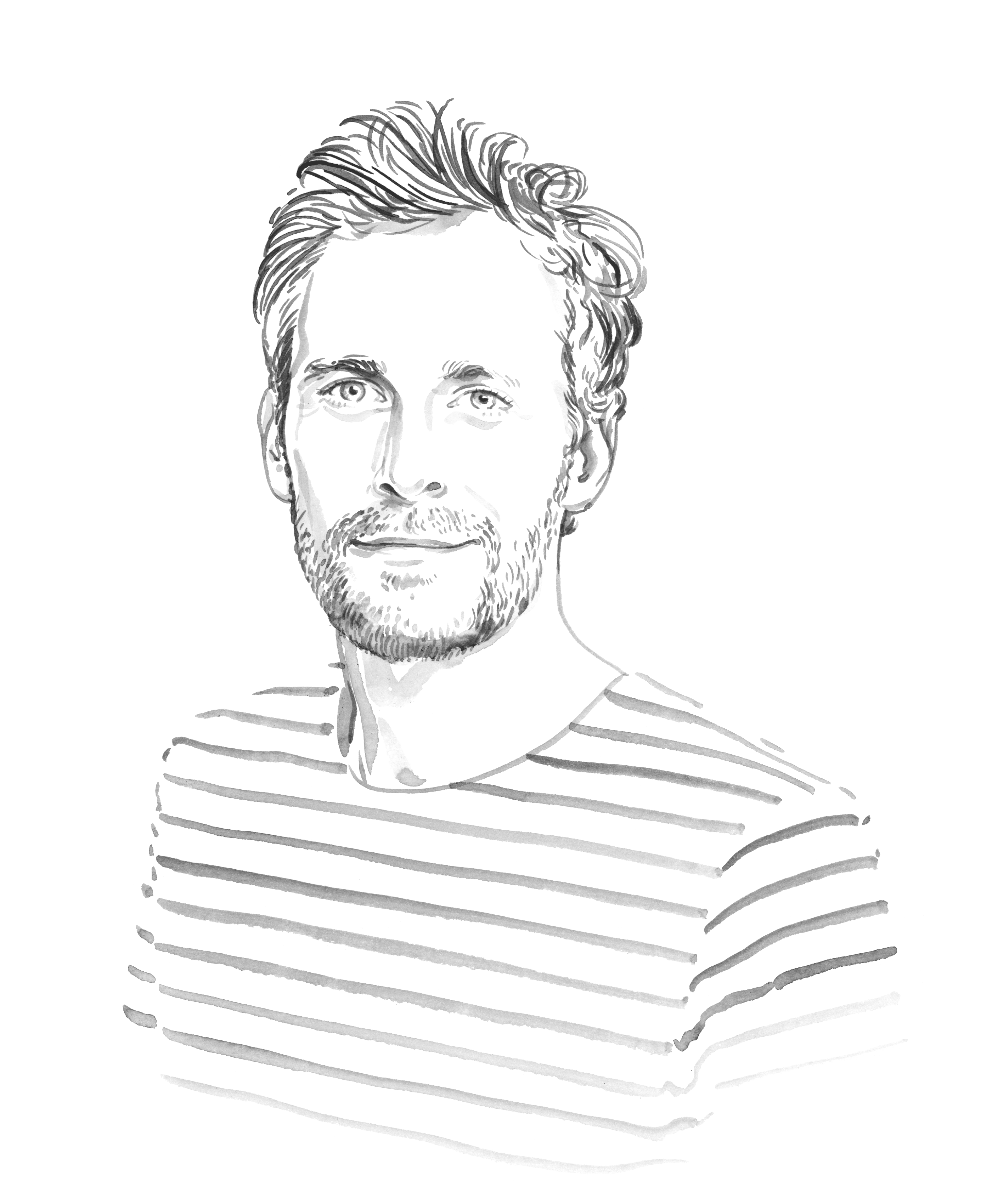

Thomas Merten
Redakteur